Vereinbaren Sie eine unverbindliche Erstberatung
Wissensdatenbank
Prolitteris: Was Unternehmen in der Schweiz (und im D-A-CH-Raum) über Pflicht, Berechnung, Ausnahmen und Einsprachen wissen müssen
Karin Gray, Associate
29.08.2025
ProLitteris – Ihre Meinung zählt!
Nehmen Sie an unserer anonymen Umfrage teil: Wie nützlich ist ProLitteris aus Ihrer Sicht als Urheber/in?
Erhalten Sie Vergütungen von ProLitteris?
Wie beurteilen Sie den Nutzen von ProLitteris für Autorinnen und Autoren in der Schweiz?
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Ihre Meinung hilft uns, die Rolle von ProLitteris für Autorinnen und Autoren besser zu verstehen.
Ihre Meinung hilft uns, die Rolle von ProLitteris für Autorinnen und Autoren besser zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Prolitteris – Rolle als Vergütungsgesellschaft Schweiz, Aufsicht (IGE), Genehmigung durch ESchK
- Gilt eine prolitteris pflicht auch ohne nachweisbare Kopien?
- Wie berechnet sich die prolitteris abgabe für Unternehmen?
- Vergleichstabelle 1: Branchen-Sätze & Freigrenzen (Unternehmen)
- Datentabelle 1: Medienspiegel-Pauschale, Mindestvergütung, 1001er-Regel, Deckelung
- Wer muss Prolitteris zahlen – und gibt es prolitteris ausnahme?
- Datentabelle 2: Verwaltung (Bund, Kantone, Gemeinden) – Pauschalen/Einwohner-Modelle
- Vergleichstabelle 2: Rechenbeispiele (Micro-GmbH, KMU, Kanzlei, Konzern)
- Wie werden Bibliotheken, Medienbeobachtung und Copyshops abgerechnet?
- Datentabelle 3: Kopierbetriebe – Vergütung pro Gerät/Jahr
- Vergleichstabelle 3: „Kein Kopiergerät“, Freigrenze, Mindestvergütung, Deckelung – Wirkung & Grenzen
- Wie laufen Meldung, Einschätzung, Widerspruch – welche Zuschläge drohen?
- Datentabelle 4: Fristen, Zuschläge, Gebühren (Überblick)
- Vergleichstabelle 4: Dritte – Abrechnungslogik im Überblick
- Ist prolitteris betrug? Wie prüfe ich die Echtheit der Forderung?
- Welche Rechtsgrundlagen und Aufsichtsmechanismen sichern Neutralität und Transparenz?
- Typische Streitpunkte – und wie Unternehmen sachlich Einspruchführen
- Drei Expertentipps (praxisnah und fallbezogen)
- Daten/Spezifikationen (zusammengefasst)
- Praxis: Welche Unterlagen sollten Sie bereithalten?
- Wie wurden die heutigen Regeln verhandelt und genehmigt?
- Checkliste zur prolitteris zahlung – in fünf Schritten
- Häufige Fragen in Stichworten
- Hinweis zum Stichwort BGE 129 III 721
- FAQ zu Prolitteris
Was ist Prolitteris – und weshalb erhalte ich eine Rechnung?
Prolitteris ist eine durch den Bund bewilligte Schweizer Vergütungsgesellschaft Schweiz. Sie zieht gesetzliche Vergütungen für das Kopieren, Speichern und interne Zugänglichmachen urheberrechtlich geschützter Texte und Bilder ein und verteilt sie an Rechteinhaber. ProLitteris untersteht der Aufsicht des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) und agiert innerhalb eines regulierten Systems gemeinsam mit SUISA, SUISSIMAGE, SSA und SWISSPERFORM. Die Bewilligung regelt u.a. Gleichbehandlung, Handeln nach festen Regeln und das Non-Profit-Gebot.
Rechnungen an Betriebe stützen sich auf den Gemeinsamen Tarif 8 (GT 8). Dieser Tarif wurde zwischen Nutzerverbänden und Verwertungsgesellschaften verhandelt und am 02.12.2022 von der Eidgenössischen Schiedskommission (ESchK) genehmigt; er gilt seit 01.01.2023 (Schweiz und Liechtenstein).
Rechnungen an Betriebe stützen sich auf den Gemeinsamen Tarif 8 (GT 8). Dieser Tarif wurde zwischen Nutzerverbänden und Verwertungsgesellschaften verhandelt und am 02.12.2022 von der Eidgenössischen Schiedskommission (ESchK) genehmigt; er gilt seit 01.01.2023 (Schweiz und Liechtenstein).
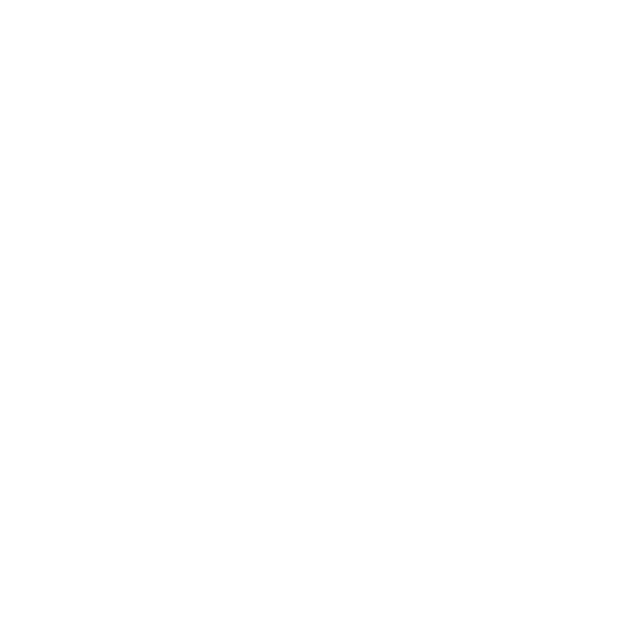
Gilt eine prolitteris pflicht auch ohne tatsächliche Kopien?
Ja. Das IGE hält fest: Für die betriebsinterne Information und Dokumentation ist eine Vergütung geschuldet; sie wird pauschal auf Basis von Annahmen festgesetzt. Ein Anspruch besteht bereits, wenn die Möglichkeit besteht, Kopien herzustellen (z. B. weil Drucker/Scanner vorhanden sind) – unabhängig vom Nachweis einzelner Kopiervorgänge.
Wie wird die prolitteris abgabe nach GT 8 berechnet?
Der GT 8 unterscheidet nach Nutzergruppen. Für Verwaltung und Unternehmen ist die Grundvergütung massgeblich; zusätzlich kann eine Medienspiegelvergütung anfallen. Kernprinzip: CHF x pro Stelle (Vollzeitäquivalent), aufgerundet. Branchen haben unterschiedliche Satzhöhen und teils Freigrenzen. Mindestvergütungen, Deckelungen und Sonderregeln sind geregelt.
Formel (Unternehmen)
Grundvergütung = (Anzahl Stellen, aufgerundet) × (Satz pro Stelle der Branche) – Freigrenze beachten; Mindestvergütung CHF 32; ab der 1001. Stelle CHF 3.20 p. Stelle. Medienspiegel: CHF 4.50 pro Stellemit Zugang zu einem oder mehreren Medienspiegeln.
Vergleichstabelle 1: Branchen-Sätze und Freigrenzen (Auszug, Unternehmen)
| Sektor/Branche (GT 8 Ziff. 3.3) | Grundvergütung pro Stelle (CHF) | Freigrenze (Stellen) |
|---|---|---|
| Industrie/Gewerbe (div. Sparten) | 3.20 | 14 |
| Banken, übrige Finanzinstitute, Leasing | 5.20 | – |
| Versicherungen, Krankenkassen | 5.20 | – |
| Rechtsanwälte, Notariate, Treuhand, Revision, Inkasso, Unternehmensberatung, Immobilienverwaltung | 8.20 | – |
| Informatik, Spitäler, Ärzte, Verbände, Kultur/Bibliotheken (je nach Ziffer) | 5.20 | – |
| Detailhandel, Grosshandel, Verkehr/Transport | 3.20 | 14 |
| Energie-/Wasserversorgung | 5.20 | 14 |
| Sportorganisationen, Sportanlagen, Coiffeure | 5.20 | 14 |
| Telekommunikationsanbieter | 3.20 | – |
| Übrige Dienstleistungsunternehmen | 5.20 | – |
Quelle: GT 8, Tabelle Sektoren und Branchen.
Datentabelle 1: Medienspiegel und Deckelung
| Position | Regel |
|---|---|
| Medienspiegelvergütung | CHF 4.50 pro Stelle/Jahr mit Zugang zum Medienspiegel |
| Deckelung Medienspiegel (Unternehmen) | +10 %-Deckel gegenüber 2020, max. 110 % der 2020 bezahlten Vergütung |
| Ausgenommen | Keine Deckelung bei Rechnung < CHF 100 |
Rechtsgrundlagen: GT 8 Ziff. 3.5–3.7; 6.1–6.3.
Wer muss ProLitteris zahlen – gibt es prolitteris ausnahme?
Kategorien mit Zahlungspflicht
- Unternehmen und Verwaltungen: sobald Kopier-/Scan-Möglichkeiten bestehen (Papier und Digital). (IGE, prolitteris.ch)
- Dritte (Bibliotheken, Medienbeobachtungsdienste, Kopierbetriebe), wenn sie für Berechtigte Vervielfältigungen herstellen oder Geräte bereitstellen – mit eigener Berechnungslogik (siehe unten). (prolitteris.ch)
Ausnahmen im GT 8
- „Kein Kopiergerät“: Die Grundvergütung entfällt bzw. halbiert sich, wenn fristgerecht und wahrheitsgemässerklärt wird, dass keine Geräte für Papier- und/oder Digitalkopien zur Verfügung stehen (separates Formular, Fristen beachten).
- Freigrenze: Für zahlreiche Gewerbe besteht eine Freigrenze bis 14 Stellen; kleine Unternehmen unterhalb dieser Schwelle zahlen keine Grundvergütung (Mindestvergütung kann greifen). Branchen ohne Freigrenze zahlen ab der ersten Stelle.
- Mindestvergütung: CHF 32.00 pro Jahr, falls das Produkt „Stellen × Satz“ niedriger liegt.
Datentabelle 2: Verwaltung (Bund/Kantone/Gemeinden)
| Einheit | Beispielberechnung |
|---|---|
| Bund (z. B. Bundesverwaltung, SUVA, Rechtspflege) | Pauschalen pro Stelle (z. B. 3.20; 5.20; 8.20) |
| Kantone/Gemeinden |
Pauschale pro Einwohner; Gemeinden bis 1’000 Ew.: CHF 140 1’001–10’000: CHF 279 10’001–20’000: CHF 558 … ab 750’001: CHF 46’006 |
Quelle: GT 8 Ziff. 3.2 (Tabellen Bund/Kantone/Gemeinden).
Vergleichstabelle 2: Rechenbeispiele (Unternehmen)
| Fall | Branche | Stellen (aufgerundet) | Freigrenze | Satz/Stelle (CHF) | Grundvergütung (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-GmbH (5 Stellen) | Übrige Dienstleistungen | 5 | – | 5.20 | 26.00 → Mindestvergütung 32.00 greift |
| KMU (12 Stellen) | Detailhandel | 12 | 14 | 3.20 | 0.00 (unter Freigrenze) |
| Beratungs-AG (18 Stellen) | Rechtsanwälte / Treuhand / Revision | 18 | – | 8.20 | 147.60 |
| Industrie-Betrieb (30 Stellen) | Maschinenbau | 30 | 14 | 3.20 | (30×3.20)=96.00 |
| Konzern-Einheit (1’050 Stellen) | Any | 1’050 | – | 3.20 | (1’000×Satz) + (50×3.20); ab der 1001. Stelle 3.20 p. Stelle |
Quelle: GT 8 Ziff. 3.3 (inkl. Mindestvergütung/1001-Regel).
Wie funktioniert die prolitteris zahlung bei Bibliotheken, Medienbeobachtung und Copyshops?
Dritte (GT 8 Ziff. 4)
- Abrechnung nach Kopienmenge zum Preis CHF 0.035 pro Vervielfältigung (pro Kopier-/Dokumentenseite bzw. audiovisuelle Kopie), multipliziert mit einem relevanten Anteil fremder Werke (Bibliotheken: Dokumentationsdienste 70 %, sonstige 35 %; Medienbeobachtungsdienste 75 %; Übrige 35 %).
- Hochschulbibliotheken: anteilige Anwendung GT 8/GT 7 je nach Hochschulanteil.
Datentabelle 3: Kopierbetriebe – Vergütung pro Gerät/Jahr
| Geräteklasse | Technische Leistung | Vergütung (CHF/Jahr) |
|---|---|---|
| A | bis 45 Kopien/Minute | 180 |
| B | 46–69 Kopien/Minute | 360 |
| C | 70–105 Kopien/Minute | 477 |
| D | ab 106 Kopien/Minute | 783 |
Quelle: GT 8 Ziff. 4.5.
Vergleichstabelle 3: Ausnahme „Kein Kopiergerät“, Freigrenze, Mindestvergütung, Deckelung
| Instrument | Wirkung | Voraussetzungen/Grenzen | Quelle |
|---|---|---|---|
| „Kein Kopiergerät“ | Grundvergütung entfällt/halbiert | Fristgerechtes, unterschriebenes Formular; keine Geräte für Papier und/oder Digital verfügbar | GT 8 Ziff. 3.4, 7.3 |
| Freigrenze | Nullbelastung bis 14 Stellen (branchenabhängig) | Gilt nicht in Branchen mit „–“ (z. B. Rechtsanwälte/Treuhand/Revision) | GT 8 Ziff. 3.3, Tabelle |
| Mindestvergütung | Untergrenze CHF 32.00 | Greift, wenn (Stellen × Satz) < 32 | GT 8 Ziff. 3.3(c) |
| Deckelung | Max. +10 % ggü. 2020 (Grund- und Medienspiegelvergütung) | Keine Deckelung bei Fusionsfällen > 10 % Stellenzuwachs; keine Deckelung < CHF 100 | GT 8 Ziff. 5–6 |
Wie läuft Meldung, Einschätzung, Widerspruch – und welche Zuschläge drohen?
Meldepflicht und Fristen
Der Nutzer meldet nach Aufforderung die notwendigen Daten vollständig und fristgerecht. Fehlen Daten, setzt die Gesellschaft eine Nachfrist. Erfolgt keine korrekte Meldung, darf ProLitteris eine Einschätzung vornehmen und entsprechend verrechnen.
Widerspruch und Zuschläge
- Widerspruch gegen Einschätzung:Fristgebunden; nach anerkanntem Widerspruch wird regulär abgerechnet. Ohne begründeten fristgerechten Widerspruch gelten Einschätzung und Vergütung als verbindlich.
- Zuschlag:Für die Einschätzung schuldet der Nutzer +10 %, min. CHF 100.
- Audit/Prüfung:Bei Stichprobe oder Zweifeln kann eine unabhängige Fachperson Daten prüfen; weicht die Vergütung zu Ungunsten des Nutzers um > 10 % ab, trägt der Nutzer die Auditkosten.
- Fakturierung/Zahlung:Jahresrechnung nach Verfahrensabschluss; 30 Tage Zahlungsfrist; Mahngebühr CHF 10; MWSt separat.
Datentabelle 4: Fristen, Zuschläge, Gebühren (GT 8)
| Punkt | Regel |
|---|---|
| Nachfrist bei fehlender Meldung | Frist zur Mängelbehebung; danach Rechnung |
| Einschätzung durch ProLitteris | Zulässig; Einstufung als „Übrige Dienstleistungsunternehmen“ möglich |
| Zuschlag bei Einschätzung | 10 % der Vergütung, mind. CHF 100 |
| Auditkosten | Trägt der Nutzer, wenn Abweichung > 10 % zu seinen Ungunsten |
| Zahlung | 30 Tage; Mahnung CHF 10; MWSt separat |
Quelle: GT 8 Ziff. 7–8.
Vergleichstabelle 4: Dritte – Abrechnungslogik im Überblick
| Kategorie | Abrechnungsbasis | Relevanter Anteil |
|---|---|---|
| Bibliotheken | CHF 0.035/Kopie × Kopienmenge × Anteil | 70 % (Dokumentationsdienste), sonst 35 % |
| Medienbeobachtungsdienste | CHF 0.035/Kopie × Kopienmenge × Anteil | 75 % |
| Übrige | CHF 0.035/Kopie × Kopienmenge × Anteil | 35 % |
| Kopierbetriebe | pro Gerät/Jahr (A–D) | – |
Quelle: GT 8 Ziff. 4.2–4.5.
Ist prolitteris betrug? Wie prüfe ich die Echtheit der Forderung?
Nein. ProLitteris ist bundesrechtlich bewilligt und wird vom IGE beaufsichtigt; Tarife werden von der ESchKgenehmigt. Rechnungen beruhen auf gesetzlichen Pauschalen; ein Anspruch besteht bereits bei Möglichkeit zur Kopie. Prüfschritte: (1) Absender „ProLitteris“; (2) Bezug auf GT 8; (3) Meldeaufforderung/Einschätzungslogik gemäss Tarif; (4) UID-Identifikation des Betriebs. Bei Zweifeln kann die IGE-Seite zur Rolle der Verwertungsgesellschaften konsultiert werden.
Welche Rechtsgrundlagen und Aufsichtsmechanismen sichern Neutralität und Transparenz?
- Bewilligung/Aufsicht (IGE): Inhalte der Bewilligung (Gleichbehandlung, feste Regeln, Non-Profit, Genehmigung von Verteilungsreglementen).
- Tarifaufsicht (ESchK): GT 8 wurde 2022 genehmigt (Beschluss 02.12.2022). Jährliche Geschäftsberichte der ESchK listen geltende Tarife/Praxis.
- Externe Kontrolle (EFK): Bundesrechnungshof prüft die Aufsicht über Verwertungsgesellschaften (Berichte veröffentlicht).)
Typische Streitpunkte – und wie Unternehmen sachlich Einspruchführen
Häufige Problemfelder
- Branchenklassifikation:Falsche Einstufung führt zu falschem „Satz pro Stelle“ oder Verlust der Freigrenze. Belegdes Tätigkeitsschwerpunkts hilft.
- Stellenzahl/Aufrundung:Unklare FTE-Berechnung, Rundungsfragen, Betriebsverbünde. Klären und dokumentieren.
- „Kein Kopiergerät“:Ausnahme zu spät/formwidrig gemeldet; mobile Geräte übersehen. Fristen/Form strikt einhalten.
- Medienspiegel:Zugang zu Medienmonitoring falsch angenommen; interne vs. externe Nutzung trennen.
- Einschätzung/Zuschlag:Verspätete/fehlende Meldung löst Zuschlag 10 % (min. CHF 100) aus; Audits bei Abweichungen.
Formeller Weg der Einwendung
- Begründeter Widerspruch innerhalb der gesetzten Frist, mit vollständigen Daten und Belegen (FTE-Aufstellung, Geräte-Inventar, Medienspiegel-Zugänge).
- Nachweis der zutreffenden Branche; bei Mischbetrieben Schwerpunkt dokumentieren.
- Fristen: Meldefrist → Nachfrist → Einschätzung → Widerspruchsfrist; bei Versäumnis gilt Einschätzung als verbindlich.
Drei Expertentipps (praxisnah und fallbezogen)
- Kleinstbetrieb ohne Geräte (prolitteris ausnahme nutzen)Führen Sie ein negatives Geräte-Inventar (Drucker/Kopierer/Scanner inkl. Mobilgeräte). Reichen Sie das Formular „Kein Kopiergerät“ fristgerecht und unterzeichnet ein. Prüfen Sie, ob externe Dienstleister Kopien für Sie herstellen (dann greifen ggf. Regeln für Dritte).
- Beratungs-/Anwaltskanzlei (Branche ohne Freigrenze)Bei Rechtsanwälte/Treuhand/Revision fällt die Freigrenze weg; massgeblich sind 8.20 CHF pro Stelle ab der ersten FTE. Überprüfen Sie FTE-Rundungen und Medienspiegelzugänge pro Arbeitsplatz, um keine Position doppelt zu deklarieren.
- Unternehmen mit Medienmonitoring:Dokumentieren Sie Zugangsberechtigungen zu Medienspiegeln und nutzen Sie ggf. Deckelungsregel (max. 110 % ggü. 2020). Prüfen Sie, ob Datenbank-Tools tatsächlich einen Medienspiegel im Sinn des GT 8 enthalten.
Daten/Spezifikationen (zusammengefasst)
- Papier- und Digitalkopien sind im GT 8 für interne Zwecke umfasst (inkl. Scans, Speichern, internes Zugänglichmachen). Nur Ausschnitte aus im Handel erhältlichen Werkexemplaren sind erlaubt; ganze Werke nur in den Sonderbereichen (Kunst/Noten) gemäss Ziff. 2.4.
- Medienspiegel: periodische/kontinuierliche Zusammenstellung (Push/Pull), inkl. Online-Beiträge, TV/Radio-Transkripte; CHF 4.50 pro Stelle.
- Deckelungen: Grundvergütung und Medienspiegel bei Unternehmen auf 110 % des Jahres 2020 begrenzt (Ausnahmen beachten).
- Durchsetzung: Factoring/Abtretung möglich; Mahngebühr CHF 10; Jahreslizenzwirkung rückwirkend ab Jahresanfang bei Zahlung.
Praxis: Welche Unterlagen sollten Sie bereithalten?
- Organigramm & Tätigkeitsprofil (für Branchenzuordnung).
- FTE-Nachweis je Kalenderjahr (aufgerundet; Stellen über Freigrenze zählen voll).
- Geräte-Inventar (Drucker/Kopierer/Scanner inkl. Mobilgeräte; für „Kein Kopiergerät“).
- Zugangslisten zu Medienspiegeln (personenbezogen/stellenbezogen).
- Vorjahresdaten (31.12.-Stichtag) für Vergleich/Deckelung.
Wie wurden die heutigen Regeln verhandelt und genehmigt?
Der GT 8 (2023–2027) ist das Ergebnis mehrjähriger Verhandlungen zwischen Nutzerverbänden (z. B. sgv, DUN, viscom u. a.) und den Verwertungsgesellschaften. Die ESchK genehmigte den neuen Tarif am 02.12.2022. ProLitteris stellt zum GT 8 ein offizielles Memo bereit; die ESchK dokumentiert Praxis/Beschlüsse in Jahresberichten.
Checkliste zur prolitteris zahlung – in fünf Schritten
- Branche prüfen und ggf. korrigieren (Nachweis Schwerpunkt).
- Stellenzahl (FTE) ermitteln, aufrunden, Freigrenze beachten. Mindestvergütung CHF 32 prüfen.
- Medienspiegelzugänge pro Stelle erfassen (CHF 4.50 p. Stelle).
- Ausnahme „Kein Kopiergerät“ frist- und formgerecht deklarieren, falls zutreffend.
- Fristen einhalten; bei Einschätzung fristgebunden widersprechen; Zuschlag 10 %/CHF 100 vermeiden.
Häufige Fragen in Stichworten
- Wer muss prolitteris zahlen?Alle Organisationen mit Möglichkeit zu Kopien/Scans für interne Zwecke (Papier/Digital).
- Prolitteris ausnahme – wann?Nur bei „Kein Kopiergerät“ (formelle Erklärung) oder unterhalb Freigrenze, je nach Branche.
- Prolitteris abgabe – wie hoch?Branchen-Satz × Stellen (aufgerundet) + ggf. Medienspiegel (CHF 4.50/Stelle). Mindestvergütung CHF 32.
- Einsprachen – Erfolgsaussichten?Sachlich belegt (Branche, Stellen, Geräte, Medienspiegel) und fristgerecht: gut. Versäumnisse führen zu verbindlicher Einschätzung und Zuschlag.
- Ist prolitteris betrug?Nein, es handelt sich um eine autorisierte Vergütungsgesellschaft unter IGE-Aufsicht; Tarife durch ESchK genehmigt.
Hinweis zum Stichwort BGE 129 III 721
Die in der Praxis anerkannte pauschale Vergütungspflicht basiert auf Gesetz (URG) und wurde in der Rechtsprechung bestätigt. Für die Praxis genügt die IGE-Leitlinie: Vergütungsanspruch besteht bereits bei Möglichkeit der Kopie; die Tariflogik ist pauschal.
Autorin: Karin Gray, Associate
Quellenkern: IGE (Aufsicht, Bewilligung, Verwertungsgesellschaften), ESchK (Tarifbeschluss 02.12.2022), GT 8 (2023–2027) inkl. Tabellen/Fristen/Deckelungen, ProLitteris-Nutzerinfos/FAQ.
Disclaimer: Dieser Beitrag ersetzt keine rechtliche Beratung. Entscheidungen sollten auf Basis der konkreten betrieblichen Verhältnisse und der jeweils aktuellen Tarife/Bescheide getroffen werden.
Quellenkern: IGE (Aufsicht, Bewilligung, Verwertungsgesellschaften), ESchK (Tarifbeschluss 02.12.2022), GT 8 (2023–2027) inkl. Tabellen/Fristen/Deckelungen, ProLitteris-Nutzerinfos/FAQ.
Disclaimer: Dieser Beitrag ersetzt keine rechtliche Beratung. Entscheidungen sollten auf Basis der konkreten betrieblichen Verhältnisse und der jeweils aktuellen Tarife/Bescheide getroffen werden.
FAQ zu Prolitteris
Prolitteris ist eine schweizerische Vergütungsgesellschaft Schweiz für Texte/Bilder. Sie zieht gesetzliche Vergütungen (z. B. nach Gemeinsamer Tarif 8) ein und steht unter Aufsicht des IGE; Tarife werden von der ESchK genehmigt.
Zahlungspflichtig sind Unternehmen/Verwaltungen, sobald intern Kopien/Scans/Speicherungen möglich sind (Papier und digital) – unabhängig vom Nachweis einzelner Kopien. Basis ist der GT 8 (2023–2027).
Formel: FTE (aufgerundet) × Satz pro Stelle je Branche; ggf. Medienspiegel zusätzlich. Beispiele: 3.20 / 5.20 / 8.20CHF pro Stelle (branchenabhängig); Mindestvergütung 32.00 CHF; ab 1001. Stelle 3.20 CHF.
Medienspiegel = regelmässige Zusammenstellung von Beiträgen (Print/Online/TV/Radio, inkl. Transkripte) für interne Zwecke. Pauschal 4.50 CHF pro Stelle mit Zugang – unabhängig von Anzahl Beiträgen/Spiegeln.
Ja: „Kein Kopiergerät“ (Papier und/oder digital) → Grundvergütung entfällt/halbiert (form- und fristgebundene Erklärung). Viele Branchen haben Freigrenze bis 14 Stellen; andere keine Freigrenze (z. B. Anwalts-/Treuhand-/Revisionsbranchen).
Sie müssen die abgefragten Daten vollständig/fristrecht liefern. Fehlen sie, darf ProLitteris einschätzen; dann 10 % Zuschlag (min. 100 CHF) und Einstufung als „Übrige Dienstleistungsunternehmen“ möglich.
Nach Mitteilung der Einschätzung setzt die Gesellschaft eine Widerspruchsfrist; reicht der Nutzer Daten frist-/formgerecht nach, wird regulär abgerechnet. Ohne begründeten Widerspruch gelten Einschätzung und Vergütung als verbindlich.
1)Branche/Satz prüfen. 2) FTE korrekt aufrunden. 3) Freigrenze (14) beachten. 4) Medienspiegel-Zugänge zählen (4.50 CHF/Stelle). 5) Deckelung: max. 110 % gegenüber 2020 (Ausnahmen beachten).
Abrechnung nach Kopienmenge × 0.035 CHF und relevantem Anteil (Bibliotheken 70 %/35 %; Medienbeobachtung 75 %). Copyshops: Gerätekategorien A–D (180–783 CHF/Jahr) pro Gerät.
Eigengebrauch (interne Information/Dokumentation) ist gesetzlich erlaubt; dafür besteht Vergütungspflicht (Art. 19 ff. URG). Der GT 8 konkretisiert die Vergütungen und Bedingungen.
Nein. Es gibt vergleichbare Systeme, aber eigene Gesellschaften/Tarife. Für Schweizer Betriebsstätten gilt der GT 8; ausländische Standorte müssen ihre nationalen Regeln separat prüfen.
Hinweis auf die aufsichtsrechtliche Einbindung: ProLitteris ist bewilligt, steht unter IGE-Aufsicht; Tarife sind von der ESchK genehmigt. Das dient der Rechtssicherheit und Gleichbehandlung.
Zur Tarifierung/Eigengebrauch existiert Rechtsprechung; maßgeblich sind die gesetzliche Lizenz (URG) und ESchK-Beschlüsse zum GT 8. Das aktenzeichenbezogene Zitieren ist fallabhängig; prüfen Sie den konkreten Entscheid im Kontext.
Rechnungen sind innert 30 Tagen fällig; Mahngebühr 10 CHF; Vergütung versteht sich ohne MWST. Mit Zahlung erhalten Nutzer eine Jahreslizenz rückwirkend auf Jahresbeginn für die im Tarif erlaubten Nutzungen.
Bei Stichprobe/Zweifel kann eine unabhängige Fachperson Daten prüfen. >10 % Abweichung zu Ungunsten des Nutzers → Nutzer trägt Auditkosten.
Der Satz pro Stelle variiert je Branche (z. B. Industrie 3.20; Banken/Versicherungen 5.20; Rechtsanwälte/Treuhand/Revision 8.20). Teilweise Freigrenze 14 Stellen; andere Branchen ohne Freigrenze.
Ja. Auch Einzelunternehmer ohne Erwerbseinkommen und Personal gelten als 1 Stelle und sind grundsätzlich vergütungspflichtig (vorbehaltlich Ausnahmen/Freigrenze/Mindestvergütung).
Nach Zahlung der Jahresvergütung wirkt die Lizenz rückwirkend auf den Jahresanfang; dadurch sind die im GT 8 geregelten Nutzungen abgedeckt.
Grundsatz: nur Ausschnitte aus im Handel erhältlichen Werkexemplaren. Sonderfälle: bildende Kunst und Noten – dort sind im GT 8 abweichende Regeln vorgesehen. Externe Veröffentlichung bleibt ausgeschlossen.
Lesen Sie auch:
Inhaltsübersicht
Fachgebiete
Standorte
Stockerstrasse, 45,
8002 Zürich
8002 Zürich
Baarerstrasse, 25,
6300 Zug
6300 Zug
Folgen Sie uns



© 2008-2026 Copyright Goldblum und Partner AG. Alle Rechte vorbehalten.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website sind nicht als Rechtsberatung gedacht und begründen kein Mandatsverhältnis. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente oder Formulare sind nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt und dürfen nicht als Rechtsberatung angesehen werden. Die Gesetze ändern sich regelmässig; daher sind die Informationen auf dieser Website möglicherweise nicht korrekt. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie einen Rechtsbeistand aufsuchen, um Ihre Rechte und Pflichten nach geltendem Recht und unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Umstände zu ermitteln.
Nach oben





