Wissensdatenbank
Stiftungen, Vereine und der Verein nach schweizerischem Recht
Louis Mummenthaler
30.06.2025
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Erstberatung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Warum sind Stiftungen und Vereine so beliebt?
- Rechtlicher Rahmen: Das Schweizer Zivilgesetzbuch
- Die Stiftung: Zweckbindung und Struktur
- Der Verein: Flexibilität mit Gemeinschaftscharakter
- Der Verein als Trägerstruktur für Projekte
- Steuerliche Behandlung von Vereinen und Stiftungen
- Stiftungsaufsicht und Transparenzpflichten
- Gründung und Verwaltung mit Goldblum.ch
- Fazit
- FAQ – Stiftungen, Vereine und der Verein
Einleitung: Warum sind Stiftungen und Vereine so beliebt?
Die Schweiz gilt seit Jahrzehnten als eines der weltweit attraktivsten Länder für die Gründung von gemeinnützigen Organisationen. Sowohl Stiftungen als auch Vereine erfreuen sich grosser Beliebtheit – nicht nur im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich, sondern zunehmend auch in der Bildungsförderung, Wissenschaft, Entwicklungszusammenarbeit oder nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung.
Ein Hauptgrund für diese Beliebtheit liegt in der rechtlichen und steuerlichen Stabilität der Schweiz. Organisationen, die in der Schweiz gegründet werden, geniessen nicht nur einen hohen internationalen Ruf, sondern profitieren auch von einem liberalen Vereinsrecht und einem stiftungsfreundlichen Umfeld. Hinzu kommt die Möglichkeit, Projekte langfristig und unabhängig vom wirtschaftlichen Eigentümer zu sichern – etwa durch eine Stiftung – oder gemeinschaftlich zu betreiben – etwa über einen Verein.
Dieser Beitrag gibt einen fundierten Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen nach schweizerischem Recht, zeigt deren Anwendungsmöglichkeiten und geht auf rechtliche sowie steuerliche Aspekte ein. Zudem kann eine Schweizer Mantelgesellschaft als flexible Ausgangsstruktur für gemeinnützige oder kulturelle Projekte genutzt werden. Die Informationen richten sich an Initiatoren von Projekten, internationale Organisationen, gemeinnützige Investoren und alle, die den rechtssicheren Aufbau nachhaltiger Strukturen in der Schweiz planen.
Ein Hauptgrund für diese Beliebtheit liegt in der rechtlichen und steuerlichen Stabilität der Schweiz. Organisationen, die in der Schweiz gegründet werden, geniessen nicht nur einen hohen internationalen Ruf, sondern profitieren auch von einem liberalen Vereinsrecht und einem stiftungsfreundlichen Umfeld. Hinzu kommt die Möglichkeit, Projekte langfristig und unabhängig vom wirtschaftlichen Eigentümer zu sichern – etwa durch eine Stiftung – oder gemeinschaftlich zu betreiben – etwa über einen Verein.
Dieser Beitrag gibt einen fundierten Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen nach schweizerischem Recht, zeigt deren Anwendungsmöglichkeiten und geht auf rechtliche sowie steuerliche Aspekte ein. Zudem kann eine Schweizer Mantelgesellschaft als flexible Ausgangsstruktur für gemeinnützige oder kulturelle Projekte genutzt werden. Die Informationen richten sich an Initiatoren von Projekten, internationale Organisationen, gemeinnützige Investoren und alle, die den rechtssicheren Aufbau nachhaltiger Strukturen in der Schweiz planen.
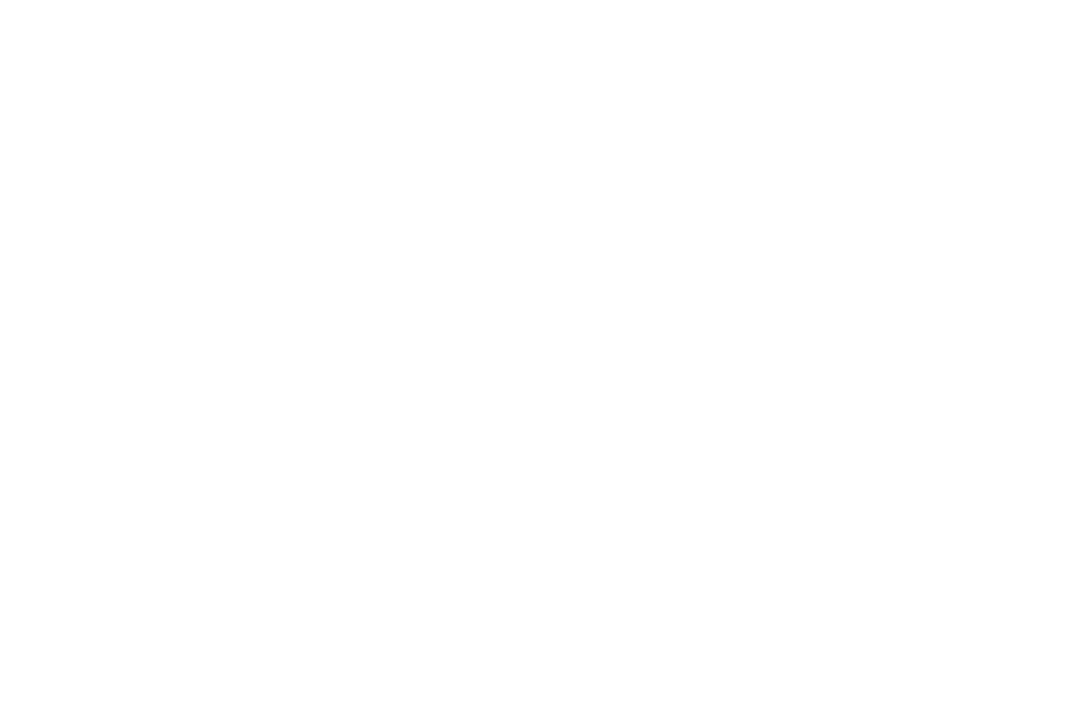
Rechtlicher Rahmen: Das Schweizer Zivilgesetzbuch
Die rechtlichen Grundlagen für Stiftungen und Vereine in der Schweiz sind im Zivilgesetzbuch (ZGB) verankert. Beide Organisationsformen sind auch eng mit den allgemeinen Anforderungen an ein Unternehmen in der Schweiz verknüpft. Während die Stiftung in den Artikeln 80 bis 89c ZGB geregelt ist, behandelt der Abschnitt über den Verein die Artikel 60 bis 79 ZGB. Beide Organisationsformen gelten als juristische Personen und besitzen die Fähigkeit, Rechte zu erwerben und Pflichten einzugehen.
Die Stiftung im ZGB
Die Stiftung wird im Artikel 80 als Vermögenswidmung zu einem bestimmten Zweck definiert. Sie entsteht durch öffentliche Beurkundung und Eintragung ins Handelsregister. Im Gegensatz zum Verein hat die Stiftung keine Mitglieder, sondern verfolgt ausschliesslich den im Stiftungsstatut festgelegten Zweck. Dieser Zweck darf nicht beliebig verändert werden und verleiht der Stiftung eine hohe langfristige Stabilität.
Der Verein im ZGB
Artikel 60 ZGB definiert den Verein als eine juristische Person, die auf die Verfolgung eines nicht wirtschaftlichen Zweckes ausgerichtet ist. Der Verein entsteht durch Annahme von Statuten durch mindestens zwei Gründungsmitglieder. Ein Handelsregistereintrag ist nur dann erforderlich, wenn der Verein eine kaufmännische Tätigkeit ausübt. Im Gegensatz zur Stiftung basiert der Verein auf einer Mitgliederstruktur, wodurch er demokratischer organisiert ist.
Rechtsfähigkeit und Haftung
Sowohl Stiftungen als auch Vereine besitzen nach ihrer Gründung volle Rechtsfähigkeit. Sie können Verträge abschliessen, Mitarbeitende anstellen, Immobilien erwerben oder Fördermittel vergeben. Die Haftung ist grundsätzlich auf das Vermögen der Organisation beschränkt. Mitglieder eines Vereins oder Stiftungsrats haften nicht persönlich, sofern sie ihre Pflichten ordnungsgemäss erfüllen.
Aufsicht und Regulierung
Stiftungen unterstehen grundsätzlich der Stiftungsaufsicht, die je nach Zweck und Tätigkeitsbereich kantonal oder eidgenössisch organisiert ist. Vereine hingegen unterliegen keiner generellen Aufsicht, es sei denn, sie verfolgen einen gemeinnützigen Zweck und beantragen eine Steuerbefreiung.
Dieser rechtliche Rahmen macht beide Organisationsformen besonders attraktiv für gemeinnützige Vorhaben, internationale Partnerschaften und langfristige Förderstrukturen. Dabei spielt auch die Besteuerung eine zentrale Rolle für die strategische Ausgestaltung solcher Organisationen. Goldblum.ch bietet in diesem Zusammenhang juristische Unterstützung bei der Formulierung der Statuten, der Aufsetzung von Gremienstrukturen sowie der Kommunikation mit Behörden.
Haben Sie Fragen?
Die Stiftung: Zweckbindung und Struktur
Die Stiftung ist eine besonders stabile Rechtsform im schweizerischen Rechtssystem. Ihr wesentliches Merkmal ist die Zweckbindung: Einmal errichtetes Vermögen wird dauerhaft einem bestimmten Zweck gewidmet und darf nicht mehr zur freien Verfügung des Stifters stehen. Dies verleiht der Stiftung eine hohe Glaubwürdigkeit, vor allem bei gemeinnützigen, philanthropischen oder wissenschaftlichen Initiativen.
Errichtung einer Stiftung
Zur Gründung einer Stiftung ist eine öffentliche Urkunde notwendig, in der die Statuten der Stiftung enthalten sind.
Diese umfassen:
Diese umfassen:
- den Namen und Sitz der Stiftung,
- den Zweck (z. B. Förderung von Bildung, Kultur, Umweltschutz),
- das gestiftete Anfangsvermögen (empfohlen mindestens CHF 50’000),
- die Organisation und Zusammensetzung des Stiftungsrats,
- Regelungen zur Rechnungslegung und Revision.
Die Stiftung erlangt ihre Rechtsfähigkeit mit dem Eintrag ins Handelsregister. Ab diesem Zeitpunkt darf das Stiftungsvermögen ausschliesslich zur Verfolgung des festgelegten Zwecks eingesetzt werden.
Zweckänderung nur in Ausnahmefällen möglich
Ein zentrales Element der Stiftung ist die Unabänderlichkeit des Zwecks. Dieser kann nur mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde angepasst werden – etwa bei Zweckverfehlung, Unmöglichkeit der Umsetzung oder geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine Änderung aus wirtschaftlichen Interessen ist ausgeschlossen.
Organstruktur: Der Stiftungsrat
Die Leitung der Stiftung obliegt dem Stiftungsrat. Dieser kann aus einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen bestehen. Der Stiftungsrat ist verantwortlich für:
- die operative Umsetzung des Stiftungszwecks,
- die Verwaltung des Vermögens,
- strategische Entscheidungen,
- die Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben.
Oftmals werden Fachgremien, Beiräte oder externe Komitees gebildet, um Expertise einzubinden und eine transparente Mittelverwendung sicherzustellen.
Vermögensstruktur und Finanzierung
Stiftungen verfügen meist über ein Grundkapital, das verzinslich angelegt oder sukzessive eingesetzt wird. Die Finanzierung erfolgt durch:
- Erträge aus dem Stiftungsvermögen (Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen),
- Spenden von Dritten,
- Zuwendungen durch öffentliche oder private Förderstellen.
Besonderheit: Unternehmensstiftungen
In der Schweiz existieren auch Stiftungen, die als Eigentümer von Unternehmen fungieren – z. B. Familienunternehmen, die über eine Stiftung kontrolliert werden. Diese sogenannte „Unternehmensstiftung“ ermöglicht:
- langfristige strategische Unabhängigkeit des Unternehmens,
- Schutz vor Verkauf oder Zerschlagung,
- Absicherung von Arbeitsplätzen und Standorten.
Goldblum.ch begleitet Stifter bei der Errichtung, Strukturierung und Verwaltung ihrer Stiftung. Dabei stehen sowohl rechtliche Stabilität als auch strategische Flexibilität im Fokus.
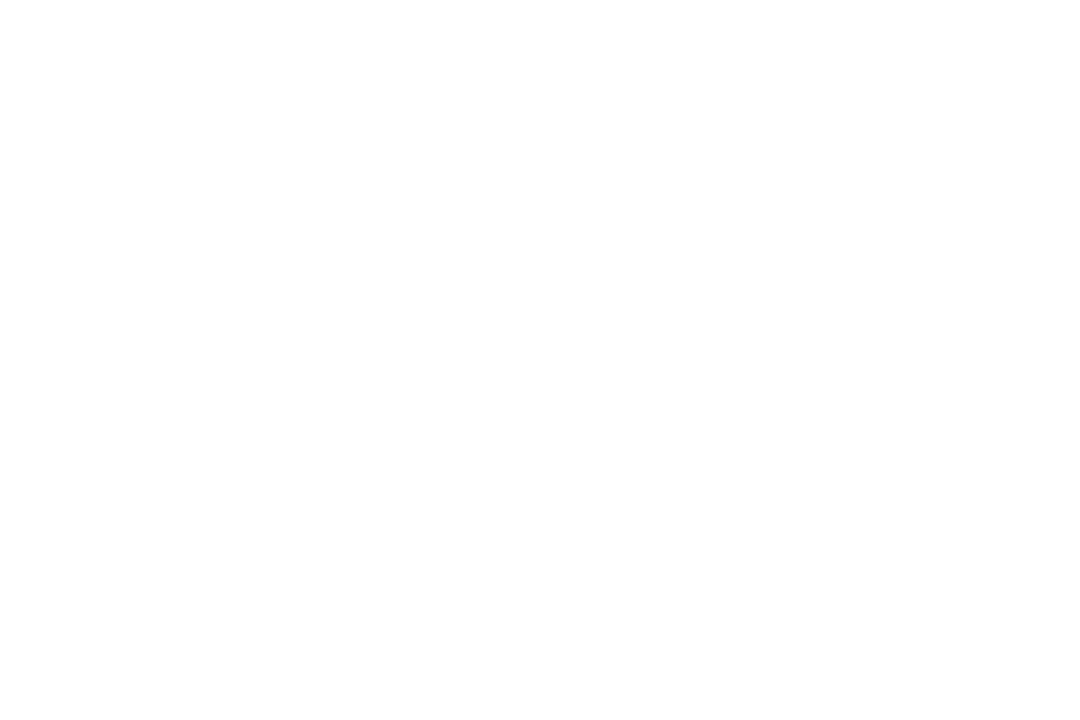
Der Verein: Flexibilität mit Gemeinschaftscharakter
Im Gegensatz zur starren Zweckbindung der Stiftung bietet der Verein eine grössere strukturelle und operative Flexibilität. Diese Rechtsform eignet sich besonders für Gruppen von Personen, die gemeinsam einen ideellen Zweck verfolgen möchten – sei es im Bereich Kultur, Sport, Gesellschaft, Umwelt oder Wissenschaft.
Gründung eines Vereins
Die Gründung eines Vereins ist in der Schweiz vergleichsweise unkompliziert.
Es bedarf:
Es bedarf:
- mindestens zwei Gründungsmitgliedern,
- der Annahme von schriftlichen Statuten,
- der Durchführung einer Gründungsversammlung.
Ein Handelsregistereintrag ist nur dann erforderlich, wenn der Verein ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Andernfalls kann der Verein ohne Publizitätspflicht und formellen Aufwand bestehen.
Struktur und Organisation
Die Organe eines Vereins bestehen in der Regel aus:
- der Generalversammlung (oberstes Organ),
- dem Vorstand (Leitung und Vertretung nach aussen),
- einer Revisionsstelle (sofern gesetzlich oder statutarisch vorgesehen).
Die Generalversammlung trifft alle grundsätzlichen Entscheidungen – etwa zur Wahl des Vorstands, Genehmigung der Jahresrechnung oder Statutenänderung. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und repräsentiert den Verein nach aussen.
Mitgliedschaft und Beiträge
Ein zentrales Merkmal des Vereins ist die offene Mitgliedschaft. Statuten regeln, wer aufgenommen wird, wie der Austritt erfolgt und ob Beiträge zu leisten sind. Viele Vereine finanzieren sich durch:
- Mitgliederbeiträge,
- freiwillige Spenden,
- öffentliche oder private Fördergelder,
- Veranstaltungserlöse oder Sponsoring.
Vorteile des Vereinsmodells
- Keine Mindestkapitalanforderung
- Demokratische Entscheidungsstruktur
- Geringe Gründungskosten
- Flexibilität bei der Zweckänderung
Einsatzmöglichkeiten
Vereine werden häufig verwendet für:
- Interessensvertretungen und Bürgerinitiativen
- Sport- und Kulturprojekte
- Alumni-Netzwerke
- Wissenschaftliche oder soziale Programme
- Trägerschaften von Schulen oder Hilfswerken
Haftung und Rechtssicherheit
Der Verein ist eine eigenständige juristische Person. Die Haftung ist in der Regel auf das Vereinsvermögen beschränkt. Persönliche Haftung der Mitglieder besteht nur, wenn dies in den Statuten ausdrücklich vorgesehen ist.
Goldblum.ch unterstützt Gründungswillige bei der Erstellung von Statuten, Durchführung der Gründungsversammlung, Eintragung (falls notwendig) und dem Aufbau interner Strukturen – rechtssicher, effizient und individuell auf den Vereinszweck zugeschnitten.
Maria Werner
Of Counsel – spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

info@goldblum.ch

+41 (44) 5152530
Der Verein als Trägerstruktur für Projekte
Immer häufiger werden Vereine in der Schweiz nicht nur für klassische Vereinszwecke gegründet, sondern dienen als organisatorische Trägerstruktur für konkrete Projekte – sei es im Bildungsbereich, in der Entwicklungszusammenarbeit, im Gesundheitswesen oder in der Kulturförderung.
Was bedeutet Trägerschaft?
Eine Trägerschaft ist eine juristische Person (z. B. ein Verein), die offiziell für ein Projekt verantwortlich ist. Sie übernimmt dabei Aufgaben wie:
- die rechtliche Vertretung des Projekts gegenüber Behörden und Dritten,
- die Anstellung und Lohnabrechnung von Mitarbeitenden,
- die Finanzverwaltung und Mittelverwendung,
- die Einhaltung von Verträgen und Förderauflagen.
Warum ist der Verein dafür geeignet?
Der Verein bietet sich als Trägerschaft an, weil:
- er mit minimalem Aufwand gegründet werden kann,
- keine Stamm- oder Mindestkapitale erforderlich sind,
- Entscheidungsprozesse demokratisch organisiert sind,
- er steuerliche Vorteile bei Gemeinnützigkeit geniessen kann,
- Projektgruppen unkompliziert rechtlich eingebunden werden können.
Beispielhafte Einsatzbereiche
- Eine Gruppe von Kulturschaffenden organisiert jährlich ein Festival. Über den Verein als Träger können Fördermittel beantragt, Verträge abgeschlossen und Mitarbeitende angestellt werden.
- Eine Initiative für berufliche Integration richtet ein Mentoring-Programm ein. Der Verein übernimmt die Verwaltung der Fördergelder und erstellt Zwischenberichte an den Kanton.
- Ein Bildungsprojekt in Afrika wird von einer Schweizer Organisation operativ betreut. Der Verein tritt dabei als Trägerschaft auf, verwaltet die Spenden und stellt die Transparenz gegenüber Donatoren sicher.
Rechtliche und steuerliche Aspekte
Besonders bei steuerlich begünstigten Strukturen gelten strenge Regeln zur Buchhaltungspflicht, die einzuhalten sind.
Wird ein Verein als Trägerschaft verwendet, muss besonders auf Folgendes geachtet werden:
Wird ein Verein als Trägerschaft verwendet, muss besonders auf Folgendes geachtet werden:
- Die Statuten müssen einen passenden Vereinszweck beschreiben.
- Förderbedingungen und Leistungsvereinbarungen müssen exakt umgesetzt werden.
- Gegebenenfalls ist eine MWST-Registrierung erforderlich.
Steuerbefreiung und Gemeinnützigkeit
Ein Projektverein kann unter bestimmten Voraussetzungen als gemeinnützig anerkannt und von der Steuerpflicht befreit werden. Dafür ist erforderlich:
- dass der Zweck uneigennützig und im öffentlichen Interesse liegt,
- dass keine privaten Gewinninteressen verfolgt werden,
- dass alle Einnahmen ausschliesslich für den Vereinszweck verwendet werden.
Goldblum.ch berät Projektinitiativen bei der Prüfung, ob der Verein die geeignete Trägerstruktur darstellt, begleitet die steuerliche Anmeldung und organisiert die Kommunikation mit Förderinstitutionen.
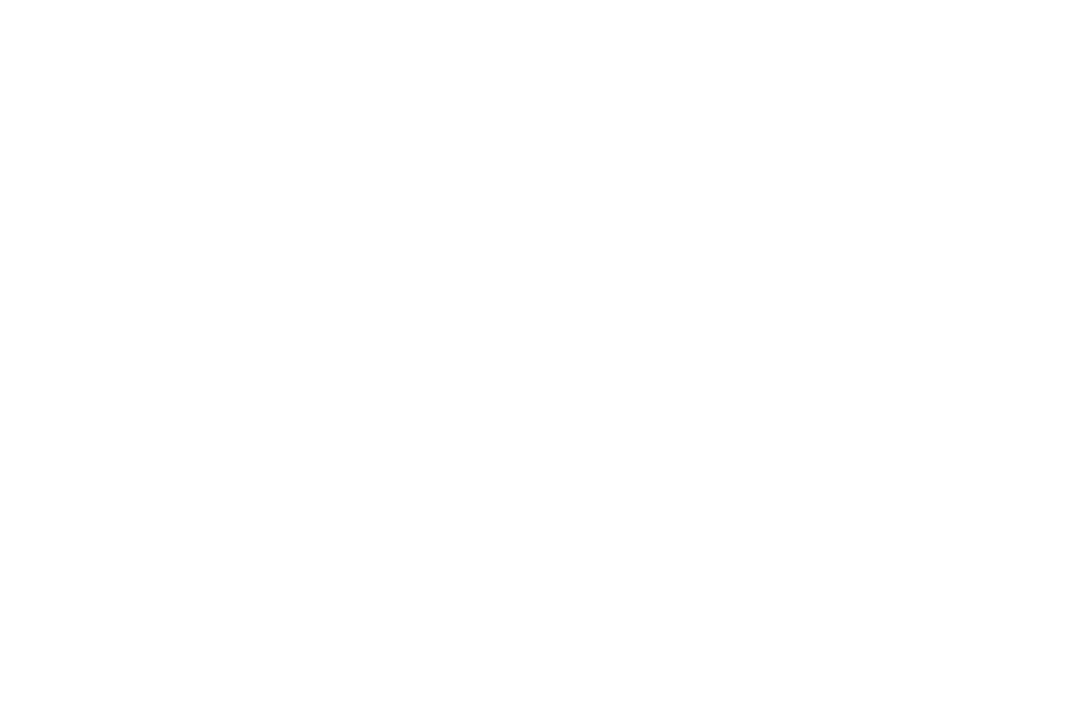
Steuerliche Behandlung von Vereinen und Stiftungen
Sowohl Vereine als auch Stiftungen können in der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuerpflicht befreit werden. Voraussetzung ist die Verfolgung eines ausschliesslich gemeinnützigen, öffentlichen oder kulturellen Zwecks – ohne Gewinnerzielungsabsicht.
Grundlage für die Steuerbefreiung
Die gesetzlichen Grundlagen für die Steuerbefreiung finden sich auf kantonaler und eidgenössischer Ebene. Zentral ist, dass:
- keine privaten wirtschaftlichen Interessen gefördert werden,
- sämtliche Mittel dem statutarisch festgelegten Zweck dienen,
- keine unangemessenen Entschädigungen an Organe erfolgen,
- eine transparente Mittelverwendung gewährleistet ist.
Vorgehen zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit
Organisationen, die eine Steuerbefreiung anstreben, müssen:
- ein Gesuch bei der zuständigen kantonalen Steuerbehörde einreichen,
- ihre Statuten beilegen,
- eine genaue Zweckbeschreibung liefern,
- Angaben zu Finanzierung, Projektplanung und Mittelverwendung machen.
Nach Prüfung erhalten sie einen schriftlichen Entscheid über die Anerkennung als steuerbefreite Organisation. Diese Anerkennung kann widerrufen werden, wenn sich der Zweck oder die tatsächliche Tätigkeit ändert.
Steuerliche Vorteile
- Befreiung von der direkten Bundessteuer
- Befreiung von kantonalen und kommunalen Gewinn- und Kapitalsteuern
- Erleichterungen bei der Mehrwertsteuerpflicht
- Möglichkeit zur Ausstellung von Spendenbestätigungen (Zuwendungsabzüge bei den Spendern)
Pflichten trotz Steuerbefreiung
Auch steuerbefreite Organisationen müssen:
- eine ordnungsgemässe Buchhaltung führen,
- jährlich einen Tätigkeitsbericht und die Jahresrechnung erstellen,
- auf Verlangen Rechenschaft gegenüber den Steuerbehörden ablegen.
Kontrollen und Missbrauchsvermeidung
Die Steuerbehörden und – im Fall von Stiftungen – auch die Aufsichtsbehörden überprüfen regelmässig, ob die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Eine verdeckte Mittelverwendung oder unangemessene Vergütung kann zur Aberkennung der Steuerbefreiung führen.
Goldblum.ch begleitet Stiftungen und Vereine bei der steuerlichen Einordnung, der Erstellung geeigneter Statuten und bei allen Kontakten mit den Behörden – inklusive der strategischen Prüfung, ob eine Steuerbefreiung sinnvoll und erreichbar ist.
Haben Sie Fragen?
Stiftungsaufsicht und Transparenzpflichten
Stiftungen in der Schweiz unterliegen einer speziellen behördlichen Kontrolle, der sogenannten Stiftungsaufsicht. Diese soll sicherstellen, dass das gestiftete Vermögen ausschliesslich für den im Stiftungsstatut definierten Zweck verwendet wird. Transparenz, Rechenschaftspflicht und Unabhängigkeit sind hierbei zentrale Prinzipien.
Organisation der Stiftungsaufsicht
- Je nach Tätigkeitsbereich und Reichweite der Stiftung ist entweder eine kantonale oder die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) zuständig:
- Lokale oder regional tätige Stiftungen: kantonale Stiftungsaufsicht
- Stiftungen mit gesamtschweizerischer oder internationaler Ausrichtung: ESA
- Die Aufsicht führt keine operative Kontrolle, sondern prüft formell:
- ob die Statuten eingehalten werden,
- ob die Mittel zweckgebunden eingesetzt werden,
- ob der Stiftungsrat gesetzeskonform handelt,
- ob die Rechnungslegung vollständig und korrekt ist.
Berichtspflichten und Dokumentation
Stiftungen müssen jährlich einen Bericht bei der Aufsichtsbehörde einreichen. Dieser umfasst:
- Jahresrechnung inklusive Bilanz und Erfolgsrechnung
- Tätigkeitsbericht
- Erläuterung relevanter Entscheidungen des Stiftungsrats
- Nachweis über die Mittelverwendung
Je nach Grösse der Stiftung kann zusätzlich eine eingeschränkte oder ordentliche Revision vorgeschrieben sein.
Transparenz gegenüber Dritten
- Neben der Berichtspflicht gegenüber der Aufsicht legen viele Stiftungen auch gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft ab.
- das Vertrauen von Spendern und Partnern,
- die Wirkung der Kommunikationsstrategie,
- die Förderchancen bei staatlichen und privaten Institutionen.
- Transparenz kann beispielsweise durch folgende Massnahmen erhöht werden:
- Veröffentlichung der Jahresberichte auf der Website
- Offenlegung der Vergabekriterien und Empfänger
- Vorstellung der Stiftungsräte und Gremien
Vereine und Rechenschaftspflichten
Anders als Stiftungen unterliegen Vereine keiner allgemeinen staatlichen Aufsicht. Nur wenn sie:
- eine Steuerbefreiung beantragt haben oder
- öffentliche Gelder erhalten, kann eine Rechenschaftspflicht bestehen.
In solchen Fällen müssen auch Vereine eine ordnungsgemässe Buchhaltung vorlegen und auf Anfrage Unterlagen bereitstellen.
Goldblum.ch übernimmt für Stiftungen und steuerbefreite Vereine die Erstellung der jährlichen Berichte, die Korrespondenz mit den Aufsichtsstellen und entwickelt Prozesse zur effektiven Umsetzung der Transparenzanforderungen.
Goldblum.ch übernimmt für Stiftungen und steuerbefreite Vereine die Erstellung der jährlichen Berichte, die Korrespondenz mit den Aufsichtsstellen und entwickelt Prozesse zur effektiven Umsetzung der Transparenzanforderungen.
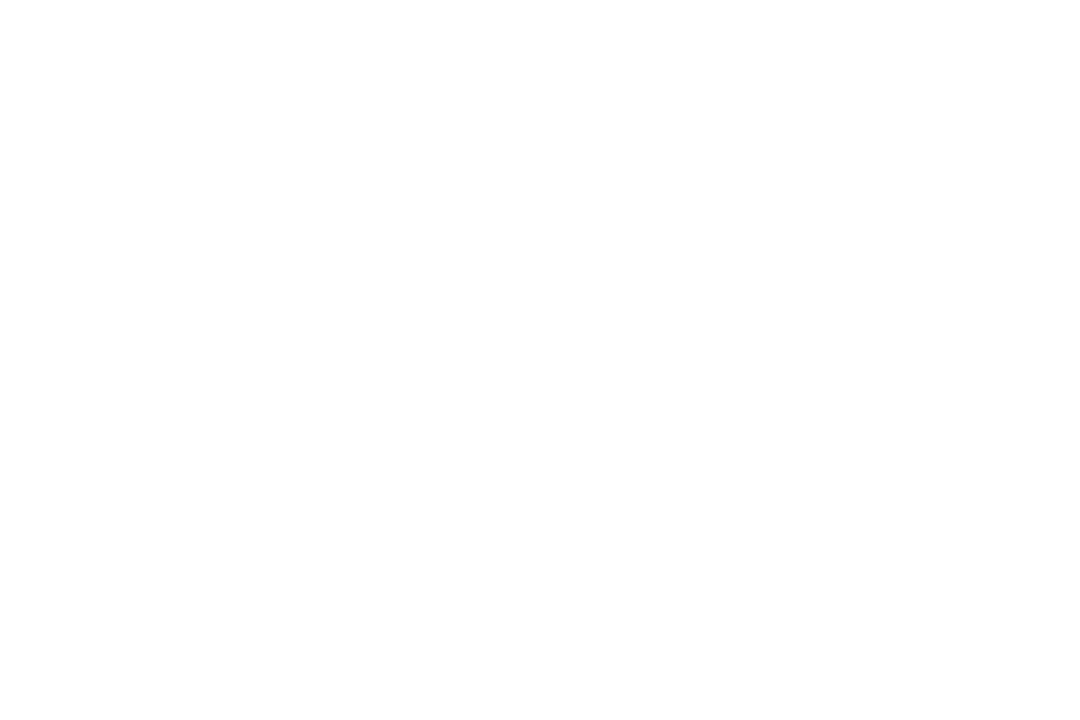
Gründung und Verwaltung mit Goldblum.ch
Die Gründung einer Stiftung oder eines Vereins in der Schweiz erfordert juristische Präzision, strategische Planung und administrative Sorgfalt. Goldblum.ch bietet umfassende Dienstleistungen für alle Phasen – von der Erstberatung über die rechtssichere Errichtung bis zur laufenden Verwaltung und Vertretung gegenüber Behörden.
- Beratung vor der GründungBereits vor dem Gründungsakt analysiert Goldblum.ch gemeinsam mit den Initianten:
- Welches Organisationsmodell (Stiftung oder Verein) passt zur Zielsetzung?
- Welche steuerlichen, aufsichtsrechtlichen oder strukturellen Anforderungen sind zu beachten?
- Welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen langfristig?
- Wie lassen sich Governance und operative Umsetzung rechtssicher verzahnen?
- Stiftungsgründung mit Goldblum.ch
- Ausarbeitung der Stiftungsurkunde und Statuten
- Koordination mit dem Notariat und dem Handelsregister
- Begleitung im Kontakt mit der kantonalen oder eidgenössischen Stiftungsaufsicht
- Aufbau des Stiftungsrats und Formulierung von Reglementen
- Strategische Positionierung gegenüber Förderern und Behörden
- Vereinsgründung mit Goldblum.ch
- Erstellung von individuell angepassten Vereinsstatuten
- Organisation und Moderation der Gründungsversammlung
- Unterstützung bei der Steuerbefreiung und MWST-Fragen
- Aufbau von Entscheidungsstrukturen und Mitgliedersystemen
- Laufende Verwaltung und ComplianceGoldblum.ch übernimmt auf Wunsch auch die vollständige Geschäftsführung oder die Teilbetreuung der Organisation.
Dies umfasst:- Führung der Buchhaltung und Erstellung des Jahresabschlusses
- Koordination mit Revisionsstellen
- Erstellung von Tätigkeitsberichten, Budgets und strategischen Planungen
- Begleitung bei Stiftungsinspektionen und Steuerprüfungen
- Beratung bei Satzungsänderungen oder Projektumstrukturierungen
Digitalisierung und moderne Verwaltung
Mit digitalen Tools wie cloudbasierter Buchhaltung, Dokumentenarchivierung und Reportinglösungen sorgt Goldblum.ch für eine effiziente, revisionssichere und transparente Organisationsführung. Auch internationale Strukturen und mehrsprachige Kommunikation werden professionell abgedeckt.
Langfristige Partnerschaft
Ob gemeinnützige Bildungsstiftung, Förderverein für Kultur oder unternehmerisch geführte Sozialinitiative – Goldblum.ch versteht sich als langfristiger Partner und entwickelt mit jeder Organisation ein Modell, das Stabilität, Wirkung und Skalierbarkeit vereint.
Haben Sie Fragen?
Fazit
Stiftungen und Vereine bieten im Schweizer Rechtssystem bewährte und vielseitig einsetzbare Strukturen für gemeinnützige, kulturelle oder soziale Vorhaben. or allem Steuern auf Dividenden können eine wichtige Rolle bei unternehmerisch geführten Stiftungen spielen. Während die Stiftung besonders für langfristige Zweckbindungen geeignet ist, überzeugt der Verein durch seine Flexibilität und Einfachheit in der Umsetzung.
Goldblum.ch unterstützt Initiatoren und Organisationen in allen Phasen – von der Gründung über die laufende Verwaltung bis zur strategischen Weiterentwicklung. Mit juristischer Klarheit, steuerlicher Kompetenz und digitaler Effizienz begleitet Goldblum.ch den Aufbau nachhaltiger Projekte in der Schweiz.
Goldblum.ch unterstützt Initiatoren und Organisationen in allen Phasen – von der Gründung über die laufende Verwaltung bis zur strategischen Weiterentwicklung. Mit juristischer Klarheit, steuerlicher Kompetenz und digitaler Effizienz begleitet Goldblum.ch den Aufbau nachhaltiger Projekte in der Schweiz.
Maria Werner
Of Counsel – spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

info@goldblum.ch

+41 (44) 5152530
FAQ – Häufige Fragen zu Stiftungen und Vereinen in der Schweiz
Eine Stiftung ist zweckgebunden und hat keine Mitglieder. Ein Verein basiert auf einer Gemeinschaft von Mitgliedern und ist demokratisch organisiert.
Die Stiftung entsteht durch eine öffentliche Urkunde, Eintragung ins Handelsregister und beinhaltet einen klar definierten Zweck mit einem gestifteten Vermögen.
Ein Verein kann mit geringem Aufwand gegründet werden, benötigt kein Kapital und ist flexibel sowie steuerlich begünstigt bei Gemeinnützigkeit.
Alle Stiftungen unterstehen einer kantonalen oder eidgenössischen Stiftungsaufsicht, die Zweckbindung und Mittelverwendung kontrolliert.
Ja, wenn der Verein einen gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Zweck verfolgt und ein entsprechendes Gesuch gestellt wird.
Durch jährliche Berichte, Rechnungslegung, Tätigkeitsnachweise und die Kontrolle durch eine Aufsichtsbehörde (ESA oder kantonal).
Eine Stiftung, die Anteile an einem Unternehmen hält, um dessen langfristige Unabhängigkeit zu sichern und Erträge zweckgebunden einzusetzen.
Nur wenn er eine kaufmännische Tätigkeit ausübt oder im Handelsverkehr wie ein Unternehmen auftritt.
Sie sind bei Gemeinnützigkeit von der Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuer befreit und dürfen Spendenquittungen ausstellen.
Goldblum.ch bietet juristische Beratung, Behördenkommunikation, Buchhaltung, Compliance, Aufbau von Strukturen und Digitalisierungslösungen.
Lesen Sie auch:
Inhaltsübersicht
Fachgebiete
Standorte
Stockerstrasse, 45,
8002 Zürich
8002 Zürich
Baarerstrasse, 25,
6300 Zug
6300 Zug
Folgen Sie uns



© 2008-2026 Copyright Goldblum und Partner AG. Alle Rechte vorbehalten.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website sind nicht als Rechtsberatung gedacht und begründen kein Mandatsverhältnis. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente oder Formulare sind nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt und dürfen nicht als Rechtsberatung angesehen werden. Die Gesetze ändern sich regelmässig; daher sind die Informationen auf dieser Website möglicherweise nicht korrekt. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie einen Rechtsbeistand aufsuchen, um Ihre Rechte und Pflichten nach geltendem Recht und unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Umstände zu ermitteln.
Nach oben





