Wissensdatenbank
Gründungsdokumente: Was Sie brauchen
Louis Mummenthaler
6. Juni, 2025
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Erstberatung
Inhaltsverzeichnis
Ziel & Einführung
Die Gründung einer Stiftung in der Schweiz erfordert weit mehr als die reine Bereitstellung eines Kapitals. Sie ist ein strukturierter, rechtlich fundierter Prozess, der zahlreiche Dokumente, Planungen und Überlegungen umfasst. Um eine gemeinnützige Stiftung erfolgreich ins Leben zu rufen, bedarf es klar formulierter Statuten, einer durchdachten Zieldefinition sowie einer fundierten Marktanalyse und eines Businessplans – insbesondere dann, wenn die Stiftung operativ tätig sein soll.
Gerade im internationalen Vergleich bietet die Schweiz ein attraktives Umfeld für Stiftungen: politisch stabil, rechtlich klar geregelt und mit hoher gesellschaftlicher Akzeptanz gemeinnütziger Aktivitäten. Doch diese Vorteile bringen auch Anforderungen mit sich. Behörden, Aufsichtsstellen und Spender erwarten von Anfang an ein hohes Maß an Professionalität, Transparenz und strategischer Ausrichtung.
Dieser Leitfaden richtet sich an Gründerinnen und Gründer, die den Aufbau einer Schweizer Stiftung professionell vorbereiten wollen. Eine solide Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen ist unverzichtbar – insbesondere in Bereichen wie dem Schweizer Arbeitsrecht, die für die Tätigkeit operativer Stiftungen oft relevant sind. Er beleuchtet die wichtigsten Dokumente, Anforderungen und inhaltlichen Schwerpunkte – von den Statuten über die rechtliche Struktur bis hin zur strategischen Planung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die notwendigen Bausteine zu vermitteln, um eine Stiftung von Anfang an nachhaltig, rechtskonform und wirksam zu gestalten.
Gerade im internationalen Vergleich bietet die Schweiz ein attraktives Umfeld für Stiftungen: politisch stabil, rechtlich klar geregelt und mit hoher gesellschaftlicher Akzeptanz gemeinnütziger Aktivitäten. Doch diese Vorteile bringen auch Anforderungen mit sich. Behörden, Aufsichtsstellen und Spender erwarten von Anfang an ein hohes Maß an Professionalität, Transparenz und strategischer Ausrichtung.
Dieser Leitfaden richtet sich an Gründerinnen und Gründer, die den Aufbau einer Schweizer Stiftung professionell vorbereiten wollen. Eine solide Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen ist unverzichtbar – insbesondere in Bereichen wie dem Schweizer Arbeitsrecht, die für die Tätigkeit operativer Stiftungen oft relevant sind. Er beleuchtet die wichtigsten Dokumente, Anforderungen und inhaltlichen Schwerpunkte – von den Statuten über die rechtliche Struktur bis hin zur strategischen Planung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die notwendigen Bausteine zu vermitteln, um eine Stiftung von Anfang an nachhaltig, rechtskonform und wirksam zu gestalten.
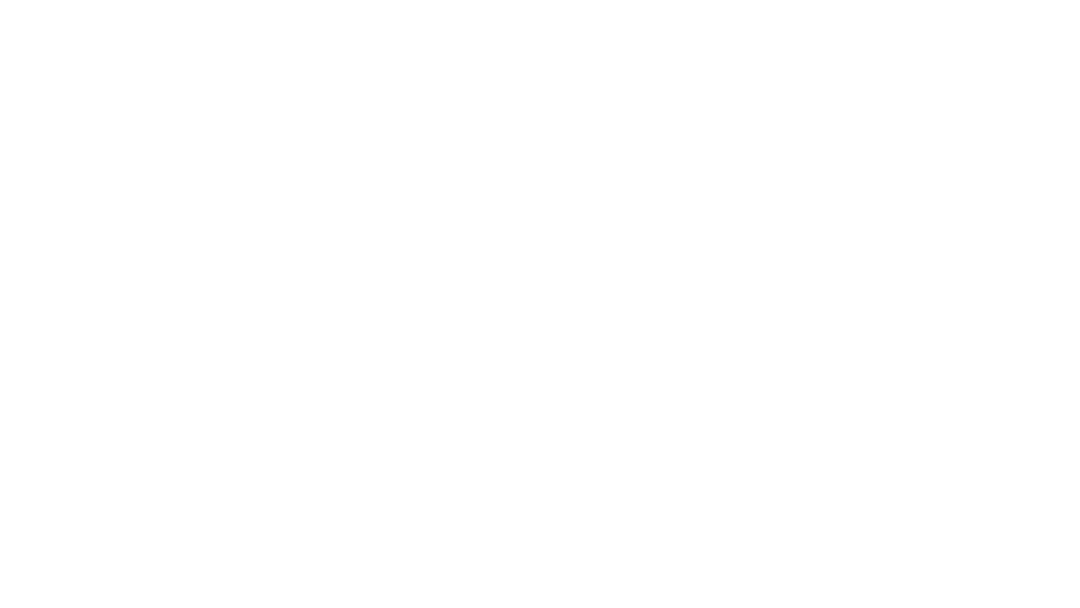
Statuten, Urkunden, Inhalte
Die Statuten bilden das Fundament jeder Stiftung in der Schweiz. Sie definieren nicht nur den Zweck der Stiftung, sondern legen auch deren Organisation, Vermögensstruktur und Entscheidungsprozesse fest. Ohne klar formulierte und juristisch einwandfreie Statuten ist eine Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht nicht möglich. Daher kommt ihrer Ausgestaltung eine zentrale Bedeutung zu.
Zu den Pflichtinhalten der Statuten gehören unter anderem:
Zu den Pflichtinhalten der Statuten gehören unter anderem:
- Stiftungszweck: Er muss eindeutig formuliert, realistisch umsetzbar und mit dem Gemeinnützigkeitsprinzip vereinbar sein.
- Stiftungsvermögen: Angabe über die Höhe und die Art des eingebrachten Grundkapitals, das dauerhaft der Stiftung zugewiesen ist.
- Organisation: Beschreibung der Gremien (insbesondere des Stiftungsrats), deren Aufgaben, Zusammensetzung, Entscheidungsverfahren und Amtsdauer.
- Domizil und Name: Angabe des offiziellen Sitzes und des Namens der Stiftung.
- Regelung zur Auflösung: Vorgehen im Fall einer späteren Auflösung der Stiftung sowie die Zuweisung des verbleibenden Vermögens.
Neben den Statuten ist die Gründungsurkunde erforderlich. Diese wird öffentlich beurkundet und enthält neben den Statuten auch die Willenserklärung zur Errichtung der Stiftung durch die Stifterin oder den Stifter. Sie ist das offizielle Startdokument, mit dem die Stiftung rechtlich begründet wird.
Weitere Dokumente wie ein Reglement zur internen Organisation, zur Geschäftsführung oder zur Vergabe von Fördermitteln sind fakultativ, aber in der Praxis sehr empfehlenswert. Sie schaffen Transparenz und Klarheit über operative Prozesse, gerade wenn die Stiftung mit externen Partnern oder Mitarbeitenden zusammenarbeitet. Auch Themen wie Sozialversicherung spielen eine wichtige Rolle, sobald Mitarbeitende eingestellt oder Förderprogramme administriert werden.
Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die inhaltliche Konsistenz: Alle Gründungsdokumente müssen inhaltlich aufeinander abgestimmt sein. Widersprüche zwischen Statuten und Reglementen können zu Problemen mit der Stiftungsaufsicht oder im operativen Alltag führen.
Deshalb empfiehlt es sich, alle Gründungsunterlagen mit juristischer Unterstützung zu erarbeiten und bereits in der Entwurfsphase mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abzustimmen. So wird sichergestellt, dass die Stiftung von Beginn an auf rechtssicheren und strategisch fundierten Grundlagen steht.
Weitere Dokumente wie ein Reglement zur internen Organisation, zur Geschäftsführung oder zur Vergabe von Fördermitteln sind fakultativ, aber in der Praxis sehr empfehlenswert. Sie schaffen Transparenz und Klarheit über operative Prozesse, gerade wenn die Stiftung mit externen Partnern oder Mitarbeitenden zusammenarbeitet. Auch Themen wie Sozialversicherung spielen eine wichtige Rolle, sobald Mitarbeitende eingestellt oder Förderprogramme administriert werden.
Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die inhaltliche Konsistenz: Alle Gründungsdokumente müssen inhaltlich aufeinander abgestimmt sein. Widersprüche zwischen Statuten und Reglementen können zu Problemen mit der Stiftungsaufsicht oder im operativen Alltag führen.
Deshalb empfiehlt es sich, alle Gründungsunterlagen mit juristischer Unterstützung zu erarbeiten und bereits in der Entwurfsphase mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abzustimmen. So wird sichergestellt, dass die Stiftung von Beginn an auf rechtssicheren und strategisch fundierten Grundlagen steht.
Haben Sie Fragen?
Anforderungen & rechtlicher Rahmen der Stiftung
Die Gründung einer Stiftung in der Schweiz unterliegt klaren gesetzlichen Vorgaben, die im Zivilgesetzbuch (ZGB, Art. 80–89bis) geregelt sind. Eine Stiftung entsteht durch eine einseitige Willenserklärung des Stifters und die Übertragung eines bestimmten Vermögens zur Erfüllung eines festgelegten Zwecks. Damit unterscheidet sie sich grundlegend von anderen juristischen Personen wie Vereinen oder Kapitalgesellschaften.
Voraussetzung für die Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht ist ein gemeinnütziger, dauerhafter Zweck, der eindeutig und erreichbar sein muss. Die Stiftung darf keinen Erwerbszweck verfolgen, sondern muss im öffentlichen Interesse oder zum Wohl einer bestimmten Zielgruppe handeln. Auch politische oder wirtschaftliche Tätigkeiten sind nur in Ausnahmefällen zulässig.
Das zur Verfügung gestellte Vermögen muss dem Stiftungszweck angemessen sein – eine gesetzliche Mindesthöhe gibt es zwar nicht, doch erwarten viele Aufsichtsbehörden eine gewisse finanzielle Basis (oft mindestens CHF 50’000 bis CHF 100’000). Entscheidend ist, dass der Zweck über Jahre hinweg erfüllt werden kann.
Rechtlich ist jede Stiftung verpflichtet, ein oberstes Organ – in der Regel den Stiftungsrat – zu benennen. Dieser ist für die Umsetzung des Zwecks und die Einhaltung der Statuten verantwortlich. Darüber hinaus sind gemeinnützige Stiftungen der staatlichen Aufsicht unterstellt. Diese prüft regelmäßig die ordnungsgemäße Geschäftsführung, Rechnungslegung und Zielverfolgung.
Bei Missachtung der rechtlichen Grundlagen drohen nicht nur Beanstandungen durch die Aufsicht, sondern schlimmstenfalls auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit oder die Auflösung der Stiftung. Um dies zu vermeiden, ist eine professionelle Vorbereitung und Begleitung der Gründung unerlässlich.
Voraussetzung für die Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht ist ein gemeinnütziger, dauerhafter Zweck, der eindeutig und erreichbar sein muss. Die Stiftung darf keinen Erwerbszweck verfolgen, sondern muss im öffentlichen Interesse oder zum Wohl einer bestimmten Zielgruppe handeln. Auch politische oder wirtschaftliche Tätigkeiten sind nur in Ausnahmefällen zulässig.
Das zur Verfügung gestellte Vermögen muss dem Stiftungszweck angemessen sein – eine gesetzliche Mindesthöhe gibt es zwar nicht, doch erwarten viele Aufsichtsbehörden eine gewisse finanzielle Basis (oft mindestens CHF 50’000 bis CHF 100’000). Entscheidend ist, dass der Zweck über Jahre hinweg erfüllt werden kann.
Rechtlich ist jede Stiftung verpflichtet, ein oberstes Organ – in der Regel den Stiftungsrat – zu benennen. Dieser ist für die Umsetzung des Zwecks und die Einhaltung der Statuten verantwortlich. Darüber hinaus sind gemeinnützige Stiftungen der staatlichen Aufsicht unterstellt. Diese prüft regelmäßig die ordnungsgemäße Geschäftsführung, Rechnungslegung und Zielverfolgung.
Bei Missachtung der rechtlichen Grundlagen drohen nicht nur Beanstandungen durch die Aufsicht, sondern schlimmstenfalls auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit oder die Auflösung der Stiftung. Um dies zu vermeiden, ist eine professionelle Vorbereitung und Begleitung der Gründung unerlässlich.
Ziel, Nutzen, Aufbau der Marktanalyse
Eine professionelle Marktanalyse gehört zu den zentralen Instrumenten bei der Gründung einer Stiftung – insbesondere dann, wenn sie operativ tätig ist oder Förderprojekte mit konkreter Zielgruppe realisiert. Sie hilft, den Bedarf zu identifizieren, die Positionierung zu schärfen und langfristige Wirkungen realistischer einschätzen zu können.
Ziel der Marktanalyse ist es, systematisch herauszufinden, in welchem gesellschaftlichen, regionalen oder thematischen Umfeld sich die Stiftung bewegen wird. Wer sind die Zielgruppen? Welche Herausforderungen bestehen vor Ort? Gibt es bereits vergleichbare Angebote? Welche Lücken möchte die Stiftung gezielt schließen?
Der Nutzen liegt auf mehreren Ebenen:
Ziel der Marktanalyse ist es, systematisch herauszufinden, in welchem gesellschaftlichen, regionalen oder thematischen Umfeld sich die Stiftung bewegen wird. Wer sind die Zielgruppen? Welche Herausforderungen bestehen vor Ort? Gibt es bereits vergleichbare Angebote? Welche Lücken möchte die Stiftung gezielt schließen?
Der Nutzen liegt auf mehreren Ebenen:
- Strategische Klarheit: Die Analyse schafft ein besseres Verständnis für die Zielgruppe und die relevanten Rahmenbedingungen.
- Effizienz: Ressourcen werden gezielter eingesetzt, unnötige Doppelstrukturen vermieden.
- Überzeugungskraft: Eine fundierte Analyse stärkt das Vertrauen von Behörden, Spendern und Partnern.
- Wirkungskontrolle: Die Marktkenntnis bildet eine solide Basis für späteres Monitoring und Evaluation.
Der Aufbau einer Marktanalyse kann variieren, umfasst aber typischerweise:
- Zielgruppenbeschreibung: Wer soll profitieren?
- Bedarfsanalyse: Was wird konkret benötigt?
- Wettbewerbsanalyse: Welche Organisationen sind bereits aktiv?
- Rahmenbedingungen: Gesetzliche, kulturelle, wirtschaftliche Aspekte
- Trends & Entwicklungen: Welche Veränderungen zeichnen sich ab?
Datenquellen können offizielle Statistiken, wissenschaftliche Studien, Gespräche mit Experten, Online-Recherchen oder eigene Befragungen sein. Wichtig ist eine objektive Herangehensweise, die qualitative wie quantitative Informationen berücksichtigt.
Für Stiftungen empfiehlt es sich, diese Analyse schon in der Gründungsphase zu integrieren – etwa als Teil des Businessplans oder zur Argumentation gegenüber der Stiftungsaufsicht. Wer weiß, wie der Markt funktioniert, kann Wirkung gezielter entfalten und langfristig erfolgreicher agieren.
Für Stiftungen empfiehlt es sich, diese Analyse schon in der Gründungsphase zu integrieren – etwa als Teil des Businessplans oder zur Argumentation gegenüber der Stiftungsaufsicht. Wer weiß, wie der Markt funktioniert, kann Wirkung gezielter entfalten und langfristig erfolgreicher agieren.
Maria Werner
Of Counsel – spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

info@goldblum.ch

+41 (44) 5152530
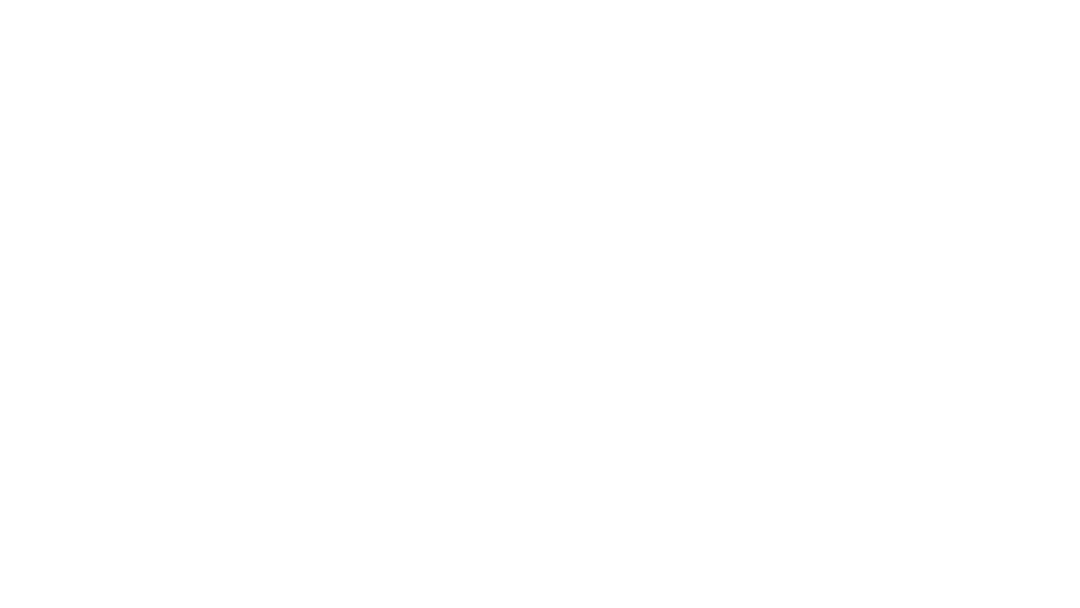
Gliederung, Inhalte, Wirkung des Businessplans
Ein Businessplan ist weit mehr als ein Dokument für Banken oder Investoren – auch im Stiftungsbereich dient er als strategischer Leitfaden. Er fasst die Vision, Ziele, Maßnahmen und Rahmenbedingungen einer Stiftung strukturiert zusammen und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Grundlage planen und handeln.
Der Businessplan dient insbesondere dazu, die Umsetzung des Stiftungszwecks zu konkretisieren, Verantwortlichkeiten zu klären und die Mittelverwendung nachvollziehbar zu gestalten. Er erhöht die interne Professionalität, verbessert die Kommunikation mit Dritten und wird von vielen Aufsichtsbehörden als Zeichen vorausschauender Planung geschätzt. Wer aus einem unternehmerischen Umfeld kommt, etwa durch ein Schweizer Start-up, bringt oft wertvolle Erfahrung für die strategische Planung einer Stiftung mit.
Typische Inhalte eines Stiftungs-Businessplans sind:
Der Businessplan dient insbesondere dazu, die Umsetzung des Stiftungszwecks zu konkretisieren, Verantwortlichkeiten zu klären und die Mittelverwendung nachvollziehbar zu gestalten. Er erhöht die interne Professionalität, verbessert die Kommunikation mit Dritten und wird von vielen Aufsichtsbehörden als Zeichen vorausschauender Planung geschätzt. Wer aus einem unternehmerischen Umfeld kommt, etwa durch ein Schweizer Start-up, bringt oft wertvolle Erfahrung für die strategische Planung einer Stiftung mit.
Typische Inhalte eines Stiftungs-Businessplans sind:
- Executive Summary: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte auf maximal zwei Seiten.
- Stiftungszweck & Vision: Was soll erreicht werden, langfristig und kurzfristig?
- Organisationsstruktur: Gremien, Zuständigkeiten, personelle Ressourcen.
- Projektplanung: Welche Aktivitäten sind vorgesehen? Welche Zeitpläne gelten?
- Finanzplan: Budget, Einnahmen (Spenden, Erträge), Ausgaben, Reserven.
- Wirkungslogik & Evaluationskonzept: Wie wird Wirkung erzielt und gemessen?
- Risikoanalyse: Welche Herausforderungen bestehen, und wie wird darauf reagiert?
- Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit: Wie wird die Stiftung sichtbar?
Die Ausgestaltung kann je nach Größe und Tätigkeitsbereich variieren. Wichtig ist, dass der Plan realistisch, umsetzbar und auf die Bedürfnisse der Stiftung zugeschnitten ist. Im Rahmen der Finanzplanung kann es sinnvoll sein, sich mit der Schweizer Mehrwertsteuer auseinanderzusetzen, vor allem bei operativen Stiftungen mit Dienstleistungen oder Einnahmen. Auch die Sprache spielt eine Rolle – ein gut verständlicher, prägnanter Stil erhöht die Lesbarkeit und Akzeptanz.
Ein durchdachter Businessplan ist ein Schlüsselinstrument für nachhaltigen Erfolg. Er macht die Vision greifbar, dient als Grundlage für strategische Entscheidungen und unterstützt dabei, die Stiftung effizient und wirksam zu führen – von der Gründungsphase bis zur langfristigen Etablierung.
Ein durchdachter Businessplan ist ein Schlüsselinstrument für nachhaltigen Erfolg. Er macht die Vision greifbar, dient als Grundlage für strategische Entscheidungen und unterstützt dabei, die Stiftung effizient und wirksam zu führen – von der Gründungsphase bis zur langfristigen Etablierung.
Fazit & Unterstützung durch Goldblum.ch
Die Gründung einer Stiftung ist ein anspruchsvoller, aber lohnenswerter Prozess. Sie bietet die Möglichkeit, langfristig gesellschaftlichen Nutzen zu stiften und Werte über Generationen hinweg zu sichern. Gerade für Gründer, die zwischen verschiedenen Organisationsformen abwägen, lohnt sich ein Blick auf den Vergleich der Rechtsformen. Damit dies gelingt, braucht es neben einem starken ideellen Antrieb vor allem eine sorgfältige, strukturierte und rechtssichere Vorbereitung.
Von der Ausarbeitung der Statuten über die Klärung des rechtlichen Rahmens bis hin zur Marktanalyse und strategischen Planung sind zahlreiche Schritte notwendig, die juristische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen erfordern. Wer hier unvorbereitet agiert, riskiert Verzögerungen, Ablehnungen durch die Aufsichtsbehörde oder eine ineffiziente operative Umsetzung.
Goldblum.ch unterstützt Stifterinnen und Stifter in allen Phasen der Gründung. Als erfahrener Partner bietet die Plattform nicht nur rechtliche und steuerliche Expertise, sondern auch strategische Beratung, individuelle Dokumentenerstellung und Begleitung bei der Kommunikation mit Behörden. So können Fehler vermieden und Abläufe beschleunigt werden. Zudem sind Schnittstellen zum Handelsregister relevant, wenn die Stiftung über Beteiligungen an Unternehmen verfügt oder gewerblich tätig wird.
Ob klassische Stiftung, operative Organisation oder hybride Modelle – Goldblum.ch entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein Gründungskonzept, das nachhaltig wirkt und den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Damit aus Ihrer Idee eine tragfähige und wirkungsvolle Stiftung wird, die Vertrauen schafft und langfristig Gutes bewirkt.
Von der Ausarbeitung der Statuten über die Klärung des rechtlichen Rahmens bis hin zur Marktanalyse und strategischen Planung sind zahlreiche Schritte notwendig, die juristische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen erfordern. Wer hier unvorbereitet agiert, riskiert Verzögerungen, Ablehnungen durch die Aufsichtsbehörde oder eine ineffiziente operative Umsetzung.
Goldblum.ch unterstützt Stifterinnen und Stifter in allen Phasen der Gründung. Als erfahrener Partner bietet die Plattform nicht nur rechtliche und steuerliche Expertise, sondern auch strategische Beratung, individuelle Dokumentenerstellung und Begleitung bei der Kommunikation mit Behörden. So können Fehler vermieden und Abläufe beschleunigt werden. Zudem sind Schnittstellen zum Handelsregister relevant, wenn die Stiftung über Beteiligungen an Unternehmen verfügt oder gewerblich tätig wird.
Ob klassische Stiftung, operative Organisation oder hybride Modelle – Goldblum.ch entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein Gründungskonzept, das nachhaltig wirkt und den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Damit aus Ihrer Idee eine tragfähige und wirkungsvolle Stiftung wird, die Vertrauen schafft und langfristig Gutes bewirkt.
Maria Werner
Of Counsel – spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

info@goldblum.ch

+41 (44) 5152530
FAQ – Häufige Fragen zur Stiftungsgründung in der Schweiz
Eine Stiftung ist eine juristische Person, die ein Vermögen dauerhaft einem bestimmten Zweck widmet. Sie wird durch eine einseitige Willenserklärung des Stifters gegründet und untersteht – bei Gemeinnützigkeit – der staatlichen Aufsicht.
Es gibt keine gesetzliche Mindesthöhe, aber die Aufsichtsbehörden erwarten in der Regel mindestens CHF 50'000 bis CHF 100'000, um den Zweck langfristig erfüllen zu können.
Erforderlich sind die Statuten, eine Gründungsurkunde (öffentlich beurkundet), sowie meist ein Organisationsreglement und – bei operativen Stiftungen – ein Businessplan.
Gemeinnützige Stiftungen unterliegen der kantonalen oder eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Diese prüft regelmäßig Geschäftsführung, Rechnungslegung und Zweckverfolgung.
Ja, wenn sie gemeinnützige Zwecke verfolgt und keine eigennützigen Interessen verfolgt, kann sie von der Steuerpflicht befreit werden – nach Prüfung durch die Steuerverwaltung.
Pflichtangaben sind Stiftungszweck, Vermögen, Organisation (z. B. Stiftungsrat), Name, Sitz und Regelungen zur Auflösung.
Operative Stiftungen führen eigene Projekte durch, während fördernde Stiftungen vor allem finanzielle Mittel an Dritte vergeben.
Ja, insbesondere für operative Stiftungen. Sie hilft, Bedarf, Zielgruppen und Wirkungspotenziale zu erfassen und effizienter zu arbeiten.
Ein Businessplan konkretisiert die Umsetzung des Zwecks, gibt Struktur und Transparenz und wird oft von Behörden oder Spendern verlangt.
Goldblum.ch begleitet Stifter professionell – von der Dokumentenerstellung über rechtliche Prüfung bis zur Eintragung und Kommunikation mit Behörden.
Lesen Sie auch:
Inhaltsübersicht
Fachgebiete
Standorte
Stockerstrasse, 45,
8002 Zürich
8002 Zürich
Baarerstrasse, 25,
6300 Zug
6300 Zug
Folgen Sie uns



© 2008-2026 Copyright Goldblum und Partner AG. Alle Rechte vorbehalten.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website sind nicht als Rechtsberatung gedacht und begründen kein Mandatsverhältnis. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente oder Formulare sind nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt und dürfen nicht als Rechtsberatung angesehen werden. Die Gesetze ändern sich regelmässig; daher sind die Informationen auf dieser Website möglicherweise nicht korrekt. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie einen Rechtsbeistand aufsuchen, um Ihre Rechte und Pflichten nach geltendem Recht und unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Umstände zu ermitteln.
Nach oben





